
seminargo Kolumne, Michl’s Corner, Vegan: Modeerscheinung oder Zukunftsmodell?
Vegan: Modeerscheinung oder Zukunftsmodell?
„Mein Körper wird kein Grab für andere Kreaturen sein!“ Leonardo da Vinci
Ich hatte bei meiner letzten Kolumne zum Hausverstand Teile aus einem Zitat von Uli Hoeneß gebracht. Das ganze Zitat lautete „Vegetarisch akzeptiere ich noch ein bisschen, vegan überhaupt nicht, weil die Leute auf Dauer nur krank werden!“
Nun dachte ich mir, ich widme diesem Thema eine ausführlichere Betrachtung. Ich habe meinen Sohn in einem natürlichen Zugang zu Essen erzogen, Gemüse aus dem Garten, Fleisch vom Förster, selbst zerwirkt und zerlegt, Fische selbst gefangen aus Fluss und Bach. Es war daher etwas spannend für mich, als er mir mit 12 Jahren eröffnete, dass er vegetarisch leben und keine Tiere mehr essen wird.
Fünf Jahre später machte er den nächsten Schritt und lebt seit damals vegan. Das war natürlich eine spannende Auseinandersetzung, aber wir führten sie auf Augenhöhe und in voller Wertschätzung.
Vor drei Jahren riss mir, bei einem zu großen Schritt mein linkes Kreuzband im Knie. Ich laborierte herum und es wollte nicht besser werden. In einem Gespräch mit dem ehemaligen Bundesligaprofi und Nationalspieler Rubin Okotie, gab Rubin mir den Tipp doch meine Ernährung umzustellen und vegan zu essen. Er hätte damit hervorragende Ergebnisse erzielt. Nach meiner ersten, ablehnenden Reaktion (war ich doch bekennender Schnitzel- und Steakfreak), dachte ich mir dann aber, wenn ich es nicht ausprobiere, könnte ich nicht urteilen.
Tatsächlich hatte ich bereits nach drei Tagen veganer Ernährung deutlich weniger Beschwerden im Knie, die Entzündung ließ nach und nach wenigen Wochen merkte ich fast keinen Unterschied mehr.
Jetzt war ich blamiert, einerseits mein Glaubenssatz, andererseits meine Gesundheit.
Ich war jedoch so überzeugt vom Ergebnis, dass ich dabei geblieben bin (mittlerweile seit 3 Jahren). Ich fühle mich fit, gesund und vital, habe Blutwerte wie ein Dreißigjähriger. Ich habe mich natürlich mittlerweile viel damit beschäftigt, viel gelesen, Studien angeschaut, Biografien und Berichte von prominenten Vertretern des veganen Lebensstils angeschaut. Die Aussagen sind immer die gleichen und decken sich mit meinen Erfahrungen.
Mittlerweile lebt ein Viertel der Altersgruppe der Fünfundzwanzigjährigen vegan. Das ist keine Modeerscheinung mehr, das ist ein Lebensstil und er wird sich durchsetzen.
Egal ob aus ökologischen Gründen, der Ablehnung von Massentierhaltung, dem Tierleid oder der eigenen Gesundheit. Mike Tyson meint : „Ich wünschte ich wäre vegan geboren, ich frage mich warum ich all die Jahre so verrückt war. Vegan zu werden hat mir eine neue Möglichkeit gegeben ein gesundes Leben zu führen.“
Euer Michl Schwind
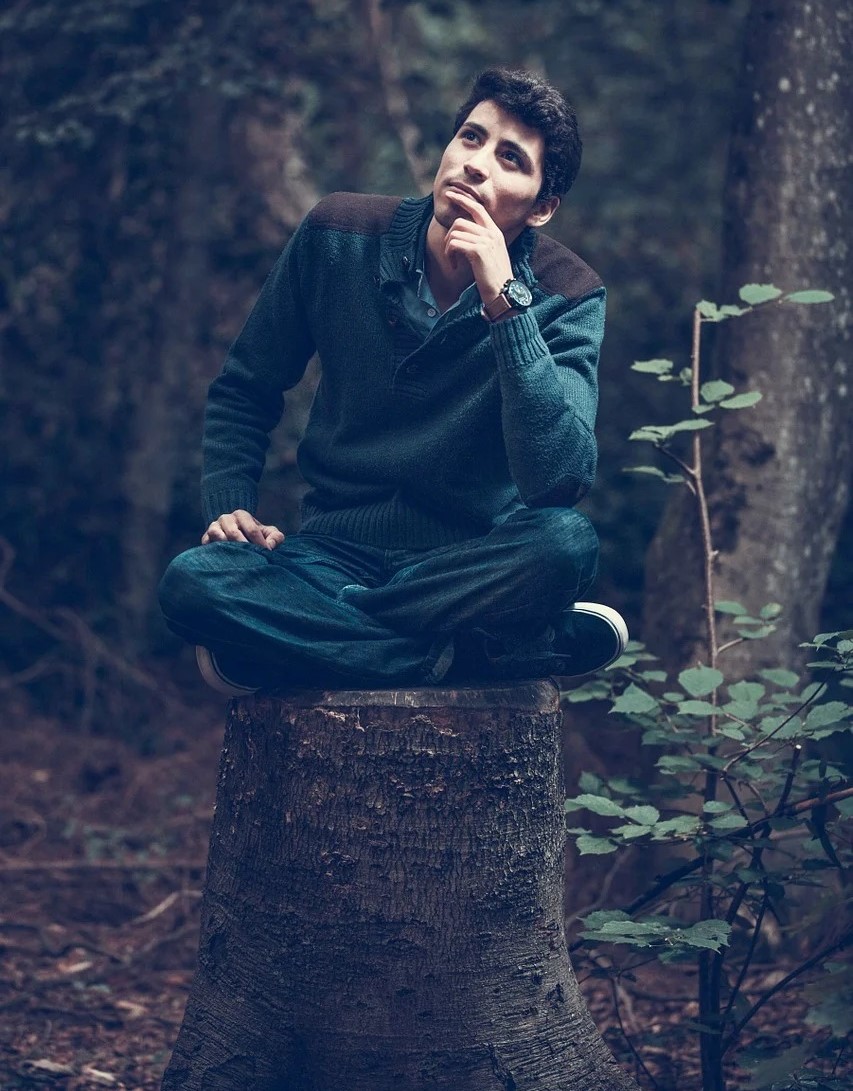
seminargo Kolumne, Michl’s Corner, Wie gescheit ist der Hausverstand wirklich?
Wie gescheit ist der Hausverstand wirklich?
„Nichts ist so gerecht verteilt, wie der gesunde Menschenverstand, niemand glaubt mehr davon zu brauchen, als er hat.“ Rene Decartes
Ob beim Billa, im Kabarett oder bei der Politik, gern wird er zitiert, der Hausverstand oder „gesunder“ Menschverstand, als Garant für das einzig Richtige, die absolute Wahrheit, oder das untrügerisch Vernünftige, die Weisheit des kleinen Mannes, der kleinen Frau. Der Hausverstand steht für eine einfache Logik, die sich an der Praxis und der Machbarkeit im Alltag orientiert und nicht aus dem Labor der Theoretiker oder den Amtsstuben der Beamten kommt.
Der Hausverstand ist erfahrungsbezogen, leicht anwendbar und simpel, er ist nicht akademisch, nicht wissenschaftlich, nicht differenziert. In einer immer komplexer werdenden Welt, in einer immer diverseren Gesellschaft, wird der Hausverstand aber dafür verwendet, einfache Antworten zu geben.
Er wird als allgemein gültiger Begriff herangezogen und gilt als universelle Messlatte, als Kritik an weltfremden Verhalten. Genau hier beginnt aber das Problem mit dem Hausverstand, weil das Wort, der Begriff, sich aus zwei Dimensionen zusammensetzt. Dem Haus und dem Verstand.
Wenn wir uns die Definition des Begriffes Verstand ansehen, so wird er beschrieben als die Fähigkeit, subjektive Empfindung in objektive Vorstellung zu verwandeln. Was jedoch ist eine objektive Vorstellung?
Zurückkommend zu dem zweiten Wortteil, Haus, so ist damit wohl gemeint die Herkunft, das Milieu, der Lebensraum. Diese bestimmt aber natürlich ganz wesentlich die objektive Vorstellung. In Ländern wie Japan und Korea ist das Tragen eines Mundnasenschutzes im Winter zur Vermeidung von gegenseitiger Ansteckung seit vielen Jahren gelebte Praxis, Teil der Kultur und objektive Vorstellung. Das Verhalten ist kulturell bedingt und gesellschaftlich geprägt. Der japanische Hausverstand spricht deutlich eine andere Sprache, übersetzt in eine andere objektive Vorstellung, als in anderen Teilen der westlichen Welt.
An diesem Beispiel wird die Grenze des Hausverstandes deutlich. Er gilt nämlich nur in meiner Welt, mit meinen Gesetzen, Regeln und Annahmen und die können bei meinem Nachbarn schon ganz anders sein.
Der eine Hausverstand kauft als Lösung für die Klimakrise ein Elektroauto, der andere Hausverstand fährt Fahrrad. Wenn der Wurstfabrikant und ehemalige Präsident des FC. Bayern meint, dass Veganer, wegen ihrer Ernährung auf Dauer krank werden, so hat sein Hausverstand, in seiner Welt natürlich recht, in einer anderen Welt ist das natürlich Quatsch.
Ich wünsch jedem Hausverstand ab zu etwas Bildungskarenz, mal über den Tellerrand schauen, ein Buch lesen, andere Meinungen hören, sich zu hinterfragen, kritisch zu sein und vor allem …. sich nicht so wichtig zu nehmen.
Euer Michl Schwind
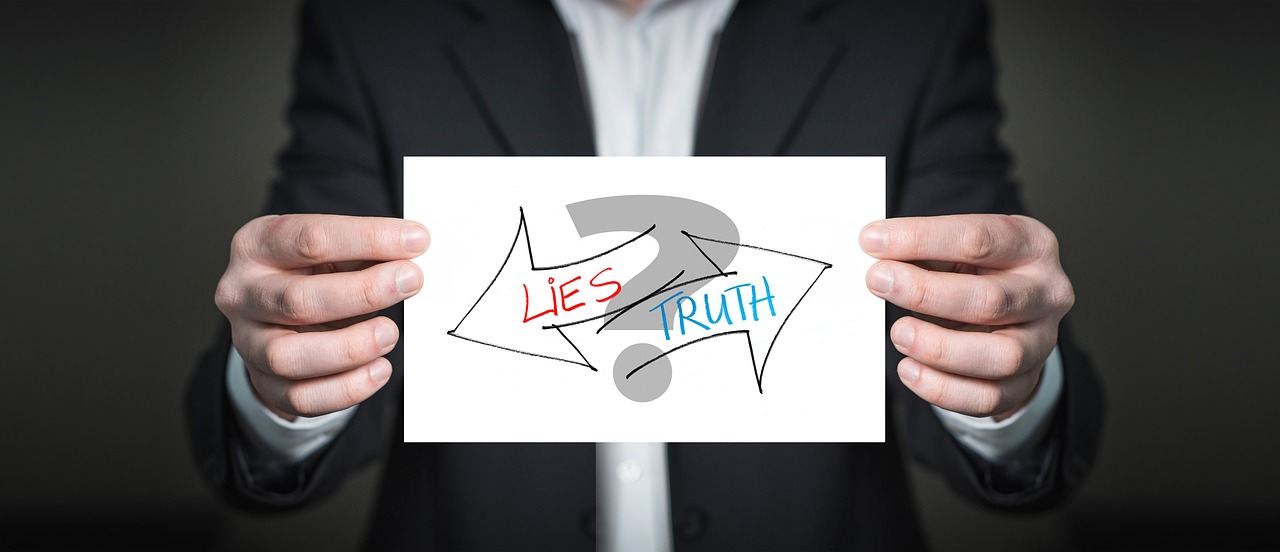
seminargo Kolumne, Michl’s Corner, Die Lüge – ein Konzept
Die Lüge – ein Konzept
„Ein Jedermann lügt – an jedem Tag, zu jeder Stunde, wach und im Schlaf, in seinen Träumen, in Freude und in Trauer; und wenn er seine Zunge still hält, werden seine Hände und Zehen, seine Augen und seine Haltung eine Täuschung vermitteln.« Mark Twain
Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Mutter, die sich über ihren fünfjährigen Sohn ärgerte, weil er ein anderes Kind im Kindergarten geschubst hatte, was der Sohn, darauf angesprochen, verneinte. Die Mutter war im Gespräch ganz aufgelöst, weil ihr Kind sie anlügt und fragte mich wie sie vorgehen soll. Nichts empört uns scheinbar so, wie wenn wir angelogen werden. Und Lügen tun immer nur die anderen. Wir selber sind immer in der Toleranz, wenn wir Dinge darstellen, die auch anders wahrgenommen werden könnten.
In unserem Alltag gibt es jede Menge Situationen, in denen wir Regeln brechen und Übertretungen begehen. Wir gehen bei Rot über die Straße, halten uns sehr überschaubar an Verkehrsregeln, schummeln in der Schule bei Prüfungen und Schularbeiten, wir kommen zu spät und erfinden irgendwelche Gründe dafür, sagen Termine ab und erfinden Verhinderungen, die Sonntagszeitung zu entnehmen ohne zu zahlen, in Werbung, Politik, Religion, Wirtschaft, Sport finden wir sie, kein Bereich des Lebens wo die reine Wahrheit vorkommt.
Leben wir also in einer verlogenen Welt?
Ich denke die Lüge hat auch ihre positiven Seiten. Laut einer Studie aus Deutschland lügen wir am Tag ca. 200 Mal. Am häufigsten in Telefonaten und im vier Augengespräch am seltensten bei schriftlicher Kommunikation wie Mail oder SMS. Die meisten davon sind sogenannte Höflichkeitslügen oder Notlügen. Wenn wir immer die Wahrheit sagen würden, wären wir sehr einsam. Soziales Zusammenleben erfordert Empathie und Kommunikationsfähigkeit, da ist manchmal schweigen, relativieren oder Diplomatie besser als Wahrheitstreue. Wir machen Komplimente, sind höflich, verschweigen. Zusammenleben erfordert eben Toleranz und Kompromisse.
Die Wahrheit ist immer kompromisslos, die Lüge sichert den Frieden. Ich meine damit nicht, dass Lügen besser ist als die Wahrheit zu sagen, mir geht es darum zu relativieren, auch im Sinne des Zitates aus der Bergpredigt : „Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, den Balken im eigenen jedoch nicht?“.
Für Kinder ist Lügen ein wichtiger Entwicklungsschritt, der es uns ermöglich Identität zu entwickeln. Wir lernen dadurch Autonomie und Selbstbestimmung, wir verbergen etwas vor den allmächtigen kontrollierenden Eltern und werden somit selbstmächtig. Als Eltern sollten wir gelassen bleiben. Das Vorbild ist wirksamer, als das pädagogische Gespräch.
Euer Michl Schwind

seminargo Kolumne, Michl’s Corner, Komfortzone
Die Komfortzone gestalten
„Das Leben beginnt dort, wo die Komfortzone endet!“, Neale Donald Walch
Die Komfortzone wird populärwissenschaftlich oft verstanden als Ort der Bequemlichkeit, der Risikolosigkeit, der Trägheit, als ein Bereich der hedonistischen Sicherheitszone, ein „Saferoom“ in dem sich die sprichwörtliche Made im Speck fett fressen kann und Entwicklung nicht stattfindet. Daher ranken sich auch zahlreiche Zitate und Sprüche um diesen sagenhaften Raum. Wenn wir aber den Blick heben und uns mit anderen bekannten Gebieten der Wissenschaft, z.B. der positiven Psychologie, der Leistungsdiagnostik, der Glücksforschung etc. beschäftigen, werden wir erkennen, dass diese Sprüche dem State-of-the-Art nicht standhalten.
Die Kernidee der Komfortzonenentwicklung ist ja, dass wir den Zustand von Sicherheit, Gewohntem und Berechenbarem verlassen und uns auf den Weg machen sollen, in dem es Wagnis, Risiko und Herausforderungen gibt, weil wir angeblich nur dadurch Neues entwickeln.
Mihaly Csikszentmihalyi der Begründer und Schöpfer der Flowtheorie, definierte Flow als einen Zustand des Tuns, bei dem die Tätigkeit im Einklang von Anforderung und Fähigkeit stattfindet. „Im Fluss sein“ (Flow) findet also dann statt, wenn Können, unsere Fähigkeiten, angewendet, erweitert und umgesetzt werden. Auch Neues wird dadurch erlebt und entdeckt, wir befinden uns beim Flowzustand, also definitiv innerhalb der Komfortzone. Das Lernen nur durch harte Erfahrung, Blut-Schweiß- und Tränen stattfinden kann, ist ein antiquierter Glaubenssatz, (….was dich nicht umbringt, macht dich härter) der hinlänglich widerlegt wurde.
Meine Idee zur erweiterten Komfortzone ist es, sie möglichst angenehm zu gestalten. Wir sollten uns neue Räume erschaffen und die eigenen erweitern und vergrößern. Weil wenn wir solche Zonen schaffen in denen es uns gut geht, wo wir Sicherheit und Freude generieren können, wird unser Lernen, das Machen neuer Erfahrungen leichter. Wir sind dann eher bereit Erfahrungen zu machen, als wenn wir durch ein Stahlbad gehen, eine Feuertaufe erleben oder eine Grenzerfahrung machen müssen. Jetzt werden manche sich fragen, wie tu ich das? In dem wir all das tun von dem wir wissen es wirkt entspannend. Spazieren gehen im Wald, sich umgeben mit Menschen die man liebt, gemeinsam oder alleine tanzen, singen, meditieren, Yoga praktizieren, einem Kind beim Spielen zusehen, mit alten Menschen Zeit verbringen, einen Garten anlegen, einen Berg besteigen, einen See durchschwimmen, einen Fluss befahren, kochen, essen, malen…
Euer Michl Schwind

seminargo Kolumne, Michl’s Corner, Die Mehrdeutigkeit balancieren
Die Mehrdeutigkeit balancieren
„Kunst muss mehrdeutig sein und falsch verstanden werden können! Sonst ist es Quatsch, sonst ist es eine Petition!!!“ Benjamin von Stuckrad-Barre
Als ich für meine letzte Kolumne das Thema Widersprüchlichkeit wählte, hatte ich mir schon Gedanken zu diesem Thema gemacht. Beide sind miteinander verwandt, haben Parallelen und doch sind sie unterschiedlich.
Der Mehrdeutigkeit, Ambiguität, liegt die Idee zu Grunde, dass Dinge, Handlungen, Sichtweisen, mehrere, unterschiedliche und auch gegensätzliche Bedeutungen haben können, ja sogar haben sollen. Es ist die Idee dem Leben Mystik zu geben in einer Welt, die nach Eindeutigkeit strebt. Das Wesen der Religion ist nach der Wahrheit zu streben, die Wahrheit zu kennen und sie zu verkünden. Das Wesen der Philosophie ist es über Wahrheiten nachzudenken, sie zu hinterfragen und neue Wahrheiten zu erschaffen.
Ambiguität schafft aber den Raum im Denken, dass mehr möglich ist. Wir kennen aus dem Sprachgebrauch Redewendungen wie: „Segen und Fluch zugleich, ein Gefühl ist kalt/warm, Lust-Angst, Wonne-Schmerz“ etc. Gleichzeitig erleben wir aber ein Streben nach Eindeutigkeit. Schwarz/Weiß, Gut/Böse, Oben/Unten, Klima, Flüchtlinge, Gendern, Geimpft/Nichtgeimpft (gerade unser aktueller, pandemischer Gesellschaftsdiskurs findet nur in der Reduzierung und Vereindeutlichung statt).
Die Psychologie kennt den Begriff der „Ambiguitätstoleranz“ (im Englischen „ambiguity“), hier wird die Fähigkeit beschrieben, Unsicherheiten oder Mehrdeutigkeiten nicht nur auszuhalten, sondern sie auch konstruktiv zu verarbeiten. Die Psychologin Else Frenkl-Brunswick definierte es als eine messbare Fähigkeit die Koexistenz von positiven und negativen Eigenschaften in ein und demselben Objekt wahrnehmen zu können. Ambiguitätstoleranz wird schon in der Kindheit angelegt und gelernt, so lernt das Kleinkind es auszuhalten, dass die Mutter nicht immer bedingungslos zur Verfügung steht, nicht immer ist die Bedürfnisbefriedigung unmittelbar möglich und doch wird das Kind die Mutter bedingungslos weiter lieben. Das Kind lernt mit der Mehrdeutigkeit zu leben.
Für uns als Erwachsene bedeutet es mehr Fragen zu stellen, als uns mit schnellen Antworten zufrieden zu geben. Eine globale vernetzte Welt mit ihren komplexen Fragestellungen, lässt sich nicht vereinfacht erklären, schon gar nicht im Schwarz/Weiß-Denken.
Der deutsche Pädagoge und Soziologe Lothar Krappmann beschreibt diesen Dialog als Balance zwischen der Ich Identität (wer ich bin) und der sozialen Identität (welche Erwartungen es an mich gibt). Worum es dabei geht, ist den Widerspruch – die Mehrdeutigkeit – auszuhalten und sie als Quelle der eigenen Entwicklung zu sehen, Fragen zu stellen und Antworten als Möglichkeit und nicht als Wirklichkeit zu sehen.
Euer Michl Schwind
Kurzbiografie Michl Schwind
Geb.: 17.08.1961
Ausbildungen und Qualifikationen:
– Sozialpädagoge
– Organisationsentwickler
– Trinergy®– NLP Lehrtrainer
– ICF Coach
– Strategisch-systemischer Kurzzeittherapeut
Menschen haben mich immer schon fasziniert. So arbeitete ich seit 20 Jahren als Sozialpädagoge und habe hier die Basis meiner psychosozialen Kompetenz entwickelt. 10 Jahre davon war ich als verantwortlicher Leiter und Führungskraft in unterschiedlichen Einrichtungen und Projekten tätig. Seit dem Jahr 2000 bin ich selbstständiger Coach, Teamtrainer und Organisationsentwickler. In dieser Zeit konnte ich bei namhaften österreichischen und internationalen Unternehmen zu deren positiver wirtschaftlicher und personeller Entwicklung beitragen.


seminargo Kolumne, Michl’s Corner, Im Widerspruch sein
Im Widerspruch sein
„Ich weiß sehr wohl, wie widersprüchlich man sein muss um wirklich konsequent zu sein!“ Pier Paolo Pasolini

Auf meine letzte Kolumne zum Thema Gewalt, erhielt ich ein interessantes Feedback.
Ich hatte zum Schluss ein Zitat von Mahatma Gandhi verwendet. Die geschätzte Leserin machte mich darauf aufmerksam, dass Gandhi einige dunkle Flecken auf seiner weißen Heldenweste habe.
Ich gestehe, das war mir zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt und das Zitat bezog sich auf die Idee der Gewaltlosigkeit. In weiterer Folge recherchierte ich natürlich und fand die angegebenen Punkte hinsichtlich Rassismus gegenüber der schwarzen Bevölkerung Südafrikas und frauenverachtenden Haltungen bestätigt (ich werde darauf hier nicht explizit eingehen, die Fakten dazu finden sich im Netz).
Mich bewegte vielmehr die Frage, ob die eine Grundhaltung (Rassismus) eine andere (Gewaltfreiheit) ausschließt, abschwächt oder unglaubwürdig macht.
Kann man einerseits menschenverachtende Züge in seiner Persönlichkeit haben und gleichzeitig friedfertig sein?
Ich glaube ja.
Mir scheint es möglich in einem Thema glaubwürdig zu sein, in einem anderen zweifelhaft. Als Menschen sind wir nun mal nicht perfekt, nicht ausgeglichen, sondern eben oft auch widersprüchlich. Wir nennen das in der Psychologie Ambivalenz. Das Vorhandensein sich widersprechender Einstellungen, Haltungen oder Sichtweisen.
Mark Twain war als politischer Journalist ein Pazifist und doch schrieb er die Memoiren von Ulysses S. Grant, dem General und Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte im Sezessionskrieg. Twain verdiente als Verleger mit diesem Buch ein Vermögen. Diego Maradona kam als Spieler nach Neapel, ins Armenhaus Italiens und führte den Klub SC Napoli zum Gewinn von Meisterschaft, Pokal, und UEFA Cup. Er bescherte den Neapolitaner*innen Selbstwert, Bedeutung und Anerkennung. Die weitere Geschichte ist bekannt und doch ist Maradona in Neapel, auch posthum noch ein Held.
Widersprüchlich zu sein, gehört zum Menschsein dazu, es ist ein Teil unserer Persönlichkeit, aber es verwirrt und empört uns, wenn wir damit in Kontakt kommen. Wir erwarten von Priestern, dass sie keusch sind (nicht weil wir glauben, dass das gut ist, sondern weil sie uns erzählen sie sind es), von Politikern, dass sie unbestechlich sind, von Managern, dass sie integer sind und doch wissen und erleben wir, dass es nicht so ist. Eine gute Idee, bleibt auch dann eine gute Idee, wenn sie von einem Scheusal kreiert wird. Ein Bösewicht kann Gutes tun und bleibt trotzdem ein Bösewicht.
„Philosophie zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Widersprüchlichkeit des Menschen uneingeschränkt zur Darstellung bring!“ Theodor W. Adorno
Euer Michl Schwind
Kurzbiografie Michl Schwind
Geb.: 17.08.1961
Ausbildungen und Qualifikationen:
– Sozialpädagoge
– Organisationsentwickler
– Trinergy®– NLP Lehrtrainer
– ICF Coach
– Strategisch-systemischer Kurzzeittherapeut
Menschen haben mich immer schon fasziniert. So arbeitete ich seit 20 Jahren als Sozialpädagoge und habe hier die Basis meiner psychosozialen Kompetenz entwickelt. 10 Jahre davon war ich als verantwortlicher Leiter und Führungskraft in unterschiedlichen Einrichtungen und Projekten tätig. Seit dem Jahr 2000 bin ich selbstständiger Coach, Teamtrainer und Organisationsentwickler. In dieser Zeit konnte ich bei namhaften österreichischen und internationalen Unternehmen zu deren positiver wirtschaftlicher und personeller Entwicklung beitragen.


seminargo Kolumne, Michl’s Corner, Wer Gewalt sät
Wer Gewalt sät
„Ein Kind das Gewalt erlebt, wird Gewalt als Lösungsweg wählen – sich selbst oder anderen gegenüber!“ Christelle Schläpfer
Vieler meiner Facebook-Kontakte hatten in den letzten Tagen auf ihren Titelbildern das Banner „Keine Gewalt gegen Frauen“ gepostet. Als Reaktion auf die hohe Zahl der Morde an Frauen, die es in diesem Jahr bereits gab. Mich hat dieser Schriftzug zunächst mal irritiert. Bitte mich nicht falsch verstehen, ich stimme dieser Aussage zu 100% zu, mich irritiert jedoch, dass hier Spielraum entsteht.
Als ich im Jahre 1981 zum Zivildienst gehen wollte, war es notwendig den Weg zur „Gewissenskommission“ zu nehmen. Dort wurden meine Beweggründe untersucht und entschieden ob ich tatsächlich keinen Dienst an der Waffe machen kann. Ich hatte mich damals schon intensiv mit Pädagogik und mit dem Phänomen der Gewalt in der Erziehung beschäftigt. Ich hatte meine Wertebildung im Thema „Gewalt als Möglichkeit zur Durchsetzung seiner Interessen“ abgeschlossen und meinen Weg als friedfertiger Mensch gefunden.
Meine Haltung hat sich in den Jahren eher verfestigt als relativiert. Gewalt als Mittel zur Durchsetzung der eigenen Interessen ist jedoch weiterhin in unserer Gesellschaft nicht geächtet. Gleichzeitig zeigen wir uns betroffen, wenn die Gewalt und ihre Auswirkungen dann sichtbar werden.
Wenn wir nicht wollen, dass es weitere Eskalationen gibt, müssen wir unsere Einstellung zur Gewalt grundsätzlich hinterfragen und ändern. In einer Studie der UNICEF aus dem Vorjahr findet jeder Zweite, dass ein Klaps auf den Hintern eines Kindes als Erziehungsmittel ok ist und meint, dass ein Kind dadurch keinen Schaden erleidet. Jeder Sechste ist Befürworter der „gsunden Watschen“.
Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, verstand seine Methode als Weg zur Verbesserung des zwischenmenschlichen Miteinanders. Dauerhafte friedliche Beziehungen gelingen nur bei einem empathischen Kontakt, durch die Art des Denkens und Sprechens. Rosenberg wendete seine Methode in den 1960er Jahren zur Überwindung (wobei Überwindung hier natürlich sehr relativ ist, wie das Beispiel George Floyd beweist) der Rassentrennung in den USA an.
Der Weg dahin, zu einer friedvollen gewaltfreien Gesellschaft ist jedoch noch ein weiter, auch Corona hat uns nicht friedlicher gemacht, sondern eher die Bereitschaft zur Eskalation verstärkt, sowohl in Wort als auch in Tat. Jedoch ist Gewalt nicht verhandelbar. Nicht gegen Kinder, nicht gegen Frauen, nicht gegen Männer, nicht gegen Tiere!
Mahatma Gandhi meinte einst „Gewalt ist das Instrument der Schwachen, Gewaltlosigkeit jene der Starken“
PS.: Matriarchale Gesellschaften kennen kaum Gewaltphänomene.
Euer Michl Schwind
Kurzbiografie Michl Schwind
Geb.: 17.08.1961
Ausbildungen und Qualifikationen:
– Sozialpädagoge
– Organisationsentwickler
– Trinergy®– NLP Lehrtrainer
– ICF Coach
– Strategisch-systemischer Kurzzeittherapeut
Menschen haben mich immer schon fasziniert. So arbeitete ich seit 20 Jahren als Sozialpädagoge und habe hier die Basis meiner psychosozialen Kompetenz entwickelt. 10 Jahre davon war ich als verantwortlicher Leiter und Führungskraft in unterschiedlichen Einrichtungen und Projekten tätig. Seit dem Jahr 2000 bin ich selbstständiger Coach, Teamtrainer und Organisationsentwickler. In dieser Zeit konnte ich bei namhaften österreichischen und internationalen Unternehmen zu deren positiver wirtschaftlicher und personeller Entwicklung beitragen.


seminargo Kolumne, Michl’s Corner, Mütter an die Macht
Mütter an die Macht
„Ich bin fürs Matriarchat, das wäre dir beste Lösung für die Welt!“ Karl Lagerfeld
Ich bin vor ein paar Jahren zum Thema Frauen im Management interviewt worden. Die Studie einer deutschen Universität kam zu dem Schluss, dass Frauen in Führungspositionen weniger verträglich wären als ihre männlichen Kollegen und wesentlich härter agieren würden.
Ich habe dem damals widersprochen und das tue ich auch heute noch, weil ich glaube, dass es keine Frage des Geschlechtes, sondern eine Frage der Kultur ist, wie wohl die Geschlechterrollen eine Kultur bestimmen und umgekehrt.
Nun bin ich über einen Artikel des argentinischen Arztes und Journalisten Ricardo Coler gestolpert, der eine zeitlang in Südchina bei einem indigenen Volk, den Mosuo, lebte, bei dem Frauen das Sagen haben. Was ich spannend an der Reportage fand, dass es nicht wie in der deutschen Studie, das gleiche System nur mit ausgetauschten Rollen war, das er beschrieb, sondern Coler von einem komplett anderen, mütterlich dominierten und gestaltetem Gesellschaftsbild berichtete.
Auffällig war die Abwesenheit von Gewalt und die Ausrichtung auf Zufriedenheit. Die Beschreibung der matriarchalen Kultur macht deutlich worin der Unterschied zu unserer Emanzipations- und Feminismusbewegung liegt.
Nicht die Frau an sich hat das Sagen, sondern die Mutter. Alles dient dem Wohl der Familie, die Lebensgestaltung, die Arbeitsaufteilung, selbst in den Beziehungsformen entscheiden die Mütter. Das Ziel einer mütterlichen Gesellschaft ist nicht die Anhäufung von Besitz, sondern die Entwicklung von sozialer Absicherung und Wohlbefinden.
Partnerschaft ist möglich, aber nicht zwingend, sie wird von Liebe und Verliebtheit getragen, Ehe und monogames Leben wie wir sie kennen eher nicht. Die Mutter sucht sich aus und entscheidet mit welchem Mann sie Sex haben möchte. Die Kinder die dabei gezeugt werden wissen nicht welcher Mann im Dorf der Vater ist. Sie werden in der Familie großgezogen und haben viele Brüder oder Onkeln. Erwachsene Männer leben mit ihren Kumpeln zusammen.
Was nach Hippieromantik klingt, ist jedoch ein wunderbar funktionierendes, friedvolles Gesellschaftmodell. Weltweit leben heute etwa 1 Mio Menschen in einer matriarchalen Gesellschaft. Der Schweizer Anthropologe Johann Jakob Bachofen verfasste erste Studien zum Mutterecht in der Mitte des 19. Jahrhundert und gilt als Begründer der Matriarchatsforschung.
Vermutlich würden wir als Gesellschaft Herausforderungen wie Pandemie, Klimawandel, Hungernöte etc. besser meistern, wenn wir unser Schicksal nicht in die Hand von stolzen Gockeln, imponier süchtigen Silberrücken oder aufgeblasenen Machos überließen, sondern unseren Müttern und wir wissen, dass sie es können.
Euer Michl Schwind
Kurzbiografie Michl Schwind
Geb.: 17.08.1961
Ausbildungen und Qualifikationen:
– Sozialpädagoge
– Organisationsentwickler
– Trinergy®– NLP Lehrtrainer
– ICF Coach
– Strategisch-systemischer Kurzzeittherapeut
Menschen haben mich immer schon fasziniert. So arbeitete ich seit 20 Jahren als Sozialpädagoge und habe hier die Basis meiner psychosozialen Kompetenz entwickelt. 10 Jahre davon war ich als verantwortlicher Leiter und Führungskraft in unterschiedlichen Einrichtungen und Projekten tätig. Seit dem Jahr 2000 bin ich selbstständiger Coach, Teamtrainer und Organisationsentwickler. In dieser Zeit konnte ich bei namhaften österreichischen und internationalen Unternehmen zu deren positiver wirtschaftlicher und personeller Entwicklung beitragen.

